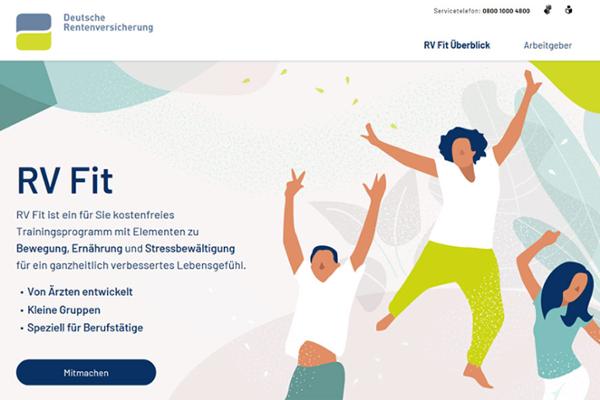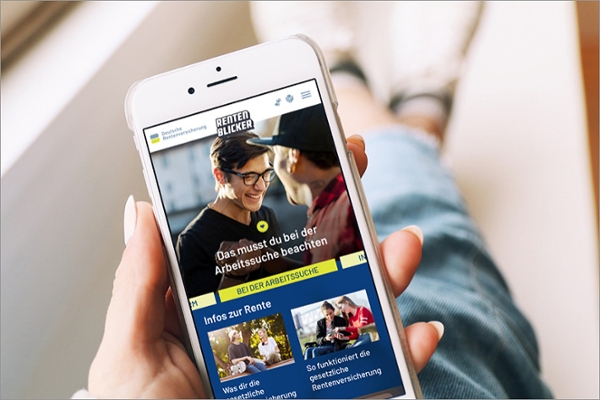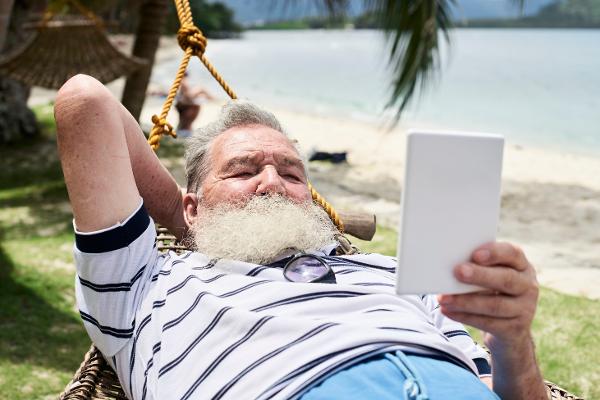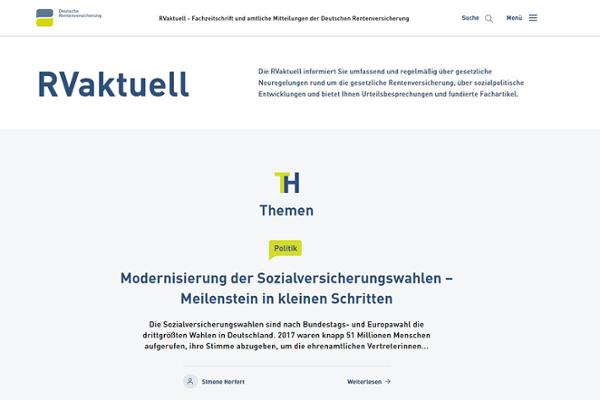Wie können wir Ihnen helfen?
Zuschlag für Erwerbsminderungsrenten
Muss ich einen Antrag stellen? Wie kommt der Zuschlag zu mir? Bekomme ich eine Nachzahlung?
Die Bundesregierung hat mit dem Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserungsgesetz Verbesserungen für Menschen eingeführt, die schon länger eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Seit Juli 2024 wird ihnen ein Zuschlag zur Rente gezahlt. Ab 1. Dezember 2025 ändert sich die Rechtsgrundlage und damit auch das Berechnungsverfahren für diesen Zuschlag.
Sie haben Fragen? Wir haben Antworten.

Wie beantrage ich meine Rente? Wie bekomme ich meine Renteninformation oder meinen Versicherungsverlauf? Diese und andere Fragen werden von Kundinnen und Kunden in unseren Auskunfts- und Beratungsstellen oft gestellt. Wir haben die häufigsten Fragen für Sie hier zusammengestellt - schauen Sie einfach mal rein, vielleicht finden Sie ja hier auch die Antwort auf Ihre Frage.
Häufige Fragen und Antworten
Meldungen
Altersvorsorge-Ansprüche auf einen Blick - Die Digitale Rentenübersicht
 Quelle:DRV
Quelle:DRV
Melden Sie sich sicher mit Ihrem Personalausweis und Ihrer persönlichen Identifikationsnummer an. Fragen Sie mit einem Klick Ihre gesetzlichen, betrieblichen und privaten Ansprüche an. Und erhalten Sie auf einen Blick die Ansprüche und Prognosen Ihrer Altersvorsorge.